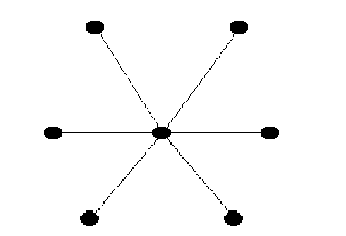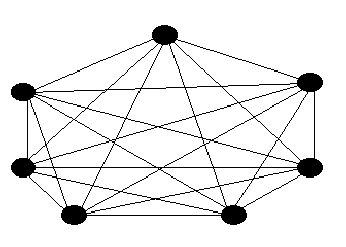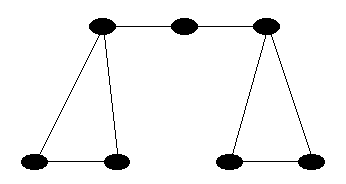Beiträge
Themengruppen
Recherche
Service
- Was ist Wissensmangement?
- Open Journal of Knowledge Management
- Artikel-Guidelines
- Newsletter
- Kalender
- Wissensmanagement-Anbieter
- Partner
- Mediadaten
Community
Sponsoren


- Wissen über Organisation und Koordination des Arbeitsprozesses,
- Wissen mit einem direkten Bezug auf das Lösen von Problemen, und
- Wissen über soziale Aspekte und persönlichen Umgang mit anderen.
- Abrahamson, E. (1996), Management Fashion, Academy of Management Review, 21, pp. 254-285.
- Allen, T.J., (1984), Managing the flow of technology: Technology transfer and the dissemination of technological information within the R&D organization, Cambridge, MA.: MIT Press.
- Baalen van P., Weggeman, M., Witteveen A. (2002), Kennis en management, Scriptum: Amsterdam
- Barker, J. (1993), Tightening the iron cage: Concertive control in self-managing teams. Administrative Science Quarterly, 38, pp. 408-437.
- Barley, S.R. Meyer G.W. en D.C. Gash (1988), Culture of cultures : Academics, practitioners and the pragmatics of normative control, Administrative Science Quarterly, 33, pp. 24-60.
- Bavelas, A., (1951), Communication patterns in task oriented groups, Journal of the Acoustical Society of America, 22, pp. 271-282.
- Benders, J., van Veen, K. (2001), "What is in a fashion: interpretive viability and management fashions" Organization, 8, pp.33-53.
- Bezemer, J. L. Karsten and K. van Veen (Revise and Resubmit) "Stretching Management Fashion Theory: an Empirical Study on the Heterogeneity of Management Fashions", Organization Studies.
- Bos, R. ( 2000), Fashion and Utopia in Management Thinking, Advances in Organization Studies, Vol.6. J.Benjamins Publishing Company, Amsterdam. Brown, J.S., Duguid, P. (2000), De waarde van informatie: een holistische benadering voor organisatie en samenleving, Pearson Education: Amsterdam.
- Castells, M. (1996), The rise of the network society, Blackwell Publishers: Oxford.
- Coleman, J.S. (1990), Foundations of Social Theory. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Collins, H.M. (1974), The TEA Set. Tacit knowledge and scientific networks, Science Studies, 4, pp.165-186.
- Davenport, T.H., Prusak, L. (1998), Working knowledge : how organizations manage what they know, Harvard Business School Press: Boston Ma.
- Dearborn, R., Simon, H. (1958), Selective perceptions in executives, Sociometry, 21, pp. 140-144.
- Eccles, R.G., Nohria, N. (1992), Networks and Organizations, Boston MA.: Harvard Business School Press.
- Flache, A. (1996), The double edge of networks. An analysis of the effect of the effect of informal networks on cooperation in social dilemmas, Amsterdam: Thesis.
- Flache, A. (2003), Je vrienden val je niet af". De negatieve effecten van informele netwerken op groepssolidariteit in werkgroepen, Gedrag & Organisatie 16, pp. 179-200.
- Gouldner, A. (1960), The norm of reciprocity: a preliminary statement. American Sociological Review, 25, pp. 161-178.
- Guillén, M.F. (1994), Models of management: work authority and organization in comparative perspective, The University of Chicago Press, Chicago Ill.
- Homans. G.C. (1974), Social Behavior. Its Elementary Forms. New York: Harcourt Implications, New York: Free Press.
- Hollander, J. (2002), Improving Performance in Business Development, Universal Press
- Jackson, K.M., Susskind, A.M. (2000), An Exploration of the Relationship Between Communication Structure and Team-Member Exchange Quality, Paper presented at the International Sunbelt Social Network Conference, Vancouver, British Columbia April 13-16.
- Janis, I.L., (1972), Groupthink, Boston: Houghton Mifflin.
- Jorna, R. (2002), De cognitieve kant van kennismanagement: over representatives, kennistypen, organisatievormen en innovatie. In: Peter van Baalen, Mathieu Weggeman, Aernoud Witteveen (eds.) Kennis en Management, Scriptum: Amsterdam, pp. 302-335.
- Karsten, L., van Veen, K. (1998), Managementconcepten in beweging: tussen feit en vluchtigheid. Van Gorcum/SMS, Assen.
- Kieser, A. (1997), Rhetoric and myth in management fashion. Organization, 4, pp. 49?76.
- Kratzer, J. (2001), Communication and Performance: An Empirical Study in Innovation Teams, Thesis Publishers: Amsterdam.
- Kratzer, J. (2004). Communicatie als succesmotor in R&D-teams, Management Executive, 3, pp. 30-33.
- Kratzer, J., Van Engelen, J.M.L., Leenders, R.T.M.J. (1998), Structuring the Communication Infrastructure of Innovation Teams for Success, Special Issue of the Journal of Product Innovation Management, pp. 43-56. Langfred, K., forthcoming, Too Much of a Good Thing? Negative Effects of High Trust and Individual Autonomy in Self-Managing Teams, Academy of Management Journal.
- Leenders, R.T.A.J., van Engelen, J.M.L., Kratzer J. (2003), Virtuality, Communication, and New Product Team Creativity: A Social Network Perspective, Journal of Engineering and Technology Management, 13, pp. 69-92.
- Marwell, G., P. Oliver (1993), The Critical Mass in Collective Action. A Micro-Social Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nystrom, H. (1979), Creativity and Innovation, New York, Toronto, John Wiley & Sons.
- Prusack, L., D. Cohen (2001), How to invest in Social Capital, Harvard Business Review, (June), pp. 86-93.
- Seashore, S.E. (1954), Group Cohesiveness in the Industrial Work Group, Ann Arbor: University of Michigan Institute for Social Research.
- Staw, Barry M.; Epstein, Lisa D.(2002), What Bandwagons Bring: Effects of Popular Management Techniques on Corporate Performance, Administrative Science Quarterly, 45, pp. 523-532.
- Uzzi, B. (1997), Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness, Administrative Science Quarterly, 42, pp. 35-67.
- van Veen, K. (2000), Meningen over managementmodes: over het nut van oude wijn in nieuwe zakken", M&O Themanummer: Organisatieadvies - wat is dat? 54e jaargang, nummer 5/6, september-december.
- Wasserman, S., Galaskiewicz, G. (1994), Advances in social network analysis, Thousand Oaks, Ca.: Sage Publications.
- Wasserman, S., Faust, K. (1994), Social Network Analysis, Cambridge: University Press. Williamson, O.E. (1975). Market and hierarchies:analysis and antitrust implications, New York: Free Press
- Wilson, R. (1985), Reputation in Games and Markets. In A. Roth (ed.) Reputation in Games and Markets, Cambridge UP, Cambridge, pp. 267-300.
- Wittek, R. (1999), Interdependence and Informal Control in Organizations. ThelaThesis: Amsterdam.
- Zuurmond, A. (2001), Informatie en leiderschap, In: Peter van Baalen, Mathieu Weggeman, Aernoud Witteveen (eds.) Kennis en Management, Scriptum: Amsterdam, pp. 186-207.
Über die Bedeutung der Analyse sozialer Netzwerke für das moderne Wissensmanagement
07. August 2005 von Dr. Jan Kratzer, Dr. Kees van VeenSowohl in der betrieblichen und unternehmensberaterischen Praxis als auch in der wissenschaftlichen Forschung zum Wissensmanagement kann das theoretische und methodische Instrumentarium der sozialen Netzwerkanalyse eine wichtige Rolle spielen. Nach einer kurzen inhaltlichen Diskussion zum Thema Wissen und Wissensmanagement werden wir an drei Beispielen aufzeigen, welchen Mehrwert die soziale Netzwerkanalyse im Rahmen von Wissensmanagement haben kann. Es wird dabei deutlich, dass die drei gewählten Beispiele eine direkte Bedeutung für Unternehmen haben. Im Einzelnen geht es um die Effizienz und Effektivität von Wissensströmen, die Rolle von Vertrauen beim Austausch von Informationen und die Bedeutung der individuellen Motivation für die Weitergabe von Informationen.
1. Einleitung
Wissensmanagement ist eines der neueren Konzepte in der heutigen Managementliteratur. Der Begriff Wissensmanagement hat sich in den letzten Jahren rapide verbreitet und trägt Züge einer Modeerscheinung (Abrahamson, 1996; Karsten und Veen, 1998; Kieser, 1997). Der populäre Charakter von Wissensmanagement erzeugt regelmäßig Widerstand bei Wissenschaftlern, Managern und Unternehmensberatern. Modererscheinungen stehen im allgemeinen im Gegensatz zu seriösem Management und sind deshalb verwerflich für jeden, der sich selbst und seinen Managementberuf ernst nimmt (Bos, 2000). Trotzdem erfüllen populäre Erscheinungen wie Wissensmanagement wichtige Funktionen. Sie sind zum Beispiel äußerst hilfreich, um neue oder bestehende Ideen in der Managementwelt schnell zu verbreiten (Veen, 2000).
Die Popularität von Wissensmanagement ist auf die zunehmende Dynamik betriebswirtschaftlicher Prozesse in vielen Unternehmen zurückzuführen (vgl. Zuurmund, 2001) und lässt sich durch drei miteinander verbundene Entwicklungen erklären. Die erste Entwicklung fand auf Makroniveau statt und bezieht sich auf den oft suggerierten Übergang von einer industriellen in eine post-industrielle Gesellschaft. Castells spricht in diesem Zusammenhang vom Aufblühen des informational capitalism (1996, p. 18). Im Stadium des informational capitalism verschiebt sich die wichtigste Quelle der Produktivität in Richtung der "technology of knowledge generation, information processing and symbolic communication" (p. 17). Dies bedeutet, dass die traditionellen Aufgaben des Managements zugunsten neuer Ziele wie z.B. der Sicherstellung von aktueller Information, effizienter Kommunikation und produktiven Wissens in den Hintergrund gedrängt werden. Als zweite Entwicklung ist zu erwähnen, dass Unternehmen in den letzten rund zwanzig Jahren Anstrengungen unternommen haben, stark hierarchische Strukturen durch weniger hierarchische, sich stärker selbstregulierende Strukturen zu ersetzen, in denen die Mitarbeiter ein größeres Maß an Selbständigkeit bekommen. Eines der bekanntesten Managementkonzepte die diese Entwicklung begleiteten war lean production. Die Folge dieser Konzepte ist, dass stets mehr Eigeninitiative und Problemlösungsfähigkeiten auf unteren Unternehmensebenen erwartet werden. Teams planen selbstständig, koordinieren die eigenen Arbeitsabläufe, lösen aufkommende Probleme unabhängig und versuchen, auf der Basis des Wissens ihrer Mitglieder einen optimalen Output zu generieren (Barker, 1993). Diese Arbeitsweise erzeugt natürlich eine höhere Komplexität der Arbeitsprozesse und stärkere Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der Teams, was eine gute Kommunikation erfordert. Darüber hinaus zeigt die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ein zunehmendes Niveau der Wissensintensität in Unternehmen (Leenders et al., 2002). Eine dritte Entwicklung, die zum Aufkommen von Wissensmanagement beigetragen hat, findet in der Mikroumgebung von Managern selbst statt. In den letzten dreißig Jahren hat die Informationstechnologie mit enormem Tempo in Unternehmen Einzug gehalten. Die Digitalisierung von Unternehmen geht Hand in Hand mit dem Versprechen der schnelleren Entschlüsselung und Verbreitung von Informationen. Diese Versprechen waren und sind die treibende Kraft in der Anwendung von Informationstechnologie. So haben auch die Potentiale dieser Technologie das Denken über das Management stark beeinflusst (Kratzer, 2004). Diese Entwicklungen zeigen, dass Wissensmanagement vielleicht die wichtigste Herausforderung für Manager in der Zukunft wird, weil Fragen über Wissens- und Informationserzeugung und -verbreitung immer mehr in den Vordergrund gedrängt werden, die Selbständigkeit der Mitarbeiter stetig wächst, und auch die Möglichkeiten der Informationstechnologie sprunghaft zunehmen. Interessant ist auch, dass die Entwicklung des Konzepts Wissensmanagement inhaltlich entscheidend durch die alltäglichen Probleme von Managern beeinflusst wird. Manager und Unternehmensberater bestimmen zum großen Teil die Diskussion und damit den Zeitplan der Entwicklung des Konzepts. Die Wissenschaft als die klassische Quelle von Wissen steht sehr oft abseits dieser Diskussion[1]. Kennzeichnend dafür ist, dass die Diskussionen über Wissensmanagement in der Praxis oft losgelöst von den gegenwärtigen wissenschaftlichen Anstrengungen geführt werden. Für eine ausführlichere Diskussion über die Entstehung und Verbreitung von Wissensmanagement siehe Bendens und Van Veen (2001), Bezemer et al. (2004), Guillen (1994) und Shaw und Epstein (2001). Wir wollen in diesem Artikel aufzeigen, dass diese Situation für beide Seiten nachteilig ist, da eine Integration beider Gedankenwelten eine fruchtbare Bereicherung sowohl für die Praxis als auch für die Wissenschaft bedeutet.
Unsere Ausführungen richten sich dabei insbesondere auf die soziale Netzwerkanalyse als ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass wissenschaftliche Entwicklungen innerhalb der Soziologie von großem Wert für die inhaltliche Entwicklung des Wissensmanagements sind. Sowohl in der betrieblichen und unternehmensberaterischen Praxis, als auch in der wissenschaftlichen Forschung zum Wissensmanagement kann das theoretische und methodische Instrumentarium der sozialen Netzwerkanalyse eine wichtige Rolle spielen. Nach einer kurzen inhaltlichen Diskussion zum Thema Wissen und Wissensmanagement werden wir an drei Beispielen aufzeigen, welchen Mehrwert die soziale Netzwerkanalyse im Rahmen von Wissensmanagement haben kann. Es wird dabei deutlich, dass die drei gewählten Beispiele eine direkte Bedeutung für Unternehmen haben. Im Einzelnen geht es um die Effizienz und Effektivität von Wissensströmen, die Rolle von Vertrauen beim Austausch von Informationen und die Bedeutung der individuellen Motivation für die Weitergabe von Informationen.
2. Kerndefinitionen von Wissensmanagement
Wie die Diskussion über Wissensmanagement in diesem Beitrag offenbart, ist dieses Konzept sehr vielseitig und hat schon zu vielen Diskussionen auf verschiedenen Gebieten geführt hat. Da es nicht unser Anliegen ist, diese Diskussion im Detail weiterzuführen, werden wir uns im folgenden auf eine kurze Einleitung in die Thematik Wissen und Wissensmanagement beschränken. Wir beziehen uns hierzu auf die Ausführungen von Davenport und Prusak in "Working Knowledge: how organizations manage what they know" (1998) und die Aufsatzsammlung in "Kennis en Management" (Van Baalen et al., 2002).
Eines der wichtigsten Fundamente von Wissensmanagement ist die Unterscheidung in Daten, Informationen und Wissen. In Unternehmen haben sich enorme Veränderungen durch verschiedenartige Anwendungen der Informationstechnologie vollzogen die die Datenverbreitung und -speicherung entscheidend beeinflussen. Unternehmen sind zunehmend in der Lage, große Datenmengen zu sammeln und zu speichern. Daten aber sind bloße Sammlungen diskreter, objektiver Tatsachen (Davenport und Prusak, 1998). Mehr Daten führen deshalb nicht automatisch zu besseren Entscheidungen im Management, sondern verursachen meist Probleme des Datenüberflusses. Darüber hinaus haben Daten selber keine Bedeutung, diese muss erst durch die Nutzer erzeugt werden (Brown und Duguid, 2000). Informationen basieren auf Daten, die kontextualisiert, kategorisiert, kalkuliert, korrigiert und kondensiert worden sind. Informationen werden zielgerichtet verbreitet von einem Sender an einen Empfänger, um das Verhalten und die Entscheidungen der Empfänger zu beeinflussen (Jorna, 2002). Informationen verbreiten sich in verschiedenen digitalen, verbalen und schriftlichen Formen innerhalb und zwischen Unternehmen. Wissen ist im Vergleich zu Informationen und Daten inhaltlich viel profunder (wesentlich breiter, tiefer und reicher). Wissen ist "... a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It originates and is applied in the mind of knowers. In organizations, it often becomes embedded not only in documents or repositories but also in organizational routines, processes, practices and norms." (Davenport und Prusak, 1998, p. 5). Daten und Informationen werden durch Vergleiche, Konsequenzen und Konservation zu Wissen. Wissen entsteht somit individuell, die Vorraussetzungen dafür können aber nur in Interaktion zwischen Individuen geschaffen werden. Das Generieren von Wissen basiert damit auf individueller Interaktion und die Erforschung von Interaktionsprozessen ist ein zentrales Thema innerhalb der Soziologie.
Der Grundgedanke von Wissensmanagement ist, Daten, Informationen und vor allem Wissen durch ein bewusstes Eingreifen mit der Zielstellung zu managen, die Gesamtleistung des Unternehmens zu erhöhen, beispielsweise dadurch, dass Kunden besser bedient, interne Prozesse besser organisiert und Erneuerungen schneller erzeugt und durchgesetzt werden. Diese Zielstellungen können um so schneller erreicht werden, je stärker die Entwicklung und Verbreitung von Wissen stimuliert werden, wie führende Vertreter des Konzepts Wissensmanagement propagieren (z.B. Jorna, 2002). Die wesentliche Frage dabei ist, wie Manager aus einer ganz praktischen Sicht dieses Ziel erreichen können.
Um diese Frage zu beantworten beziehen sich Davenport und Prusak (1998) auf eine Reihe von Basiskonzepten, die sie der Soziologie entlehnen. Sie betrachten dabei Unternehmen als Märkte, auf denen Wissen gehandelt wird und Käufer, Verkäufer und Vermittler in Kontakt treten. Die Marktteilnehmer verhandeln über Wissen und sind damit beschäftigt, Nachfrage und Angebot durch eine permanente Preisbestimmung miteinander abzustimmen. Kommen die Verhandlungspartner zu keiner Preisabsprache, wird das Verhandlungsobjekt Wissen nicht getauscht und folglich auch nicht weiter verbreitet. Der Preis von Informationen und Wissen ist in diesem Fall natürlich kaum monetär auszudrücken, sondern wird durch andere Faktoren bestimmt. Davenport und Prusak (1998) beschreiben verschiedene Mechanismen und Faktoren, die bei dem Verhandlungsprozess um Wissen eine Rolle spielen. Als erstes weisen sie auf die Bedeutung von Reziprozität hin. Mitarbeiter tauschen besonders gerne Wissen mit anderen Mitarbeitern, wenn diese über Wissen verfügen, das sie früher oder später selbst sehr gut gebrauchen könnten. Auf diese Weise entstehen ganze Systeme zeitlich verschobener Tauschgeschäfte, die eine große Bedeutung für das Funktionieren von Unternehmen besitzen. Ein zweiter wichtiger Faktor bezieht sich auf die Bedeutung von Wissen für die eigene Reputation. Eine Reputation als Experte verstärkt in den meisten Fällen die eigene Position innerhalb einer Unternehmung und kann zu Nebeneffekten wie einer größeren Arbeitsplatzsicherheit oder eines schnelleren beruflichen Aufstiegs führen. Ein weiterer Einflussfaktor für das Funktionieren von Wissensmärkten ist Vertrauen. Davenport und Prusak (1998) betonen, dass Vertrauen nur entstehen kann, wenn es auch wahrgenommen wird. Vertrauen muss deshalb sichtbar oder deutlich ausgestrahlt werden. Es spielt eine große Rolle in persönlichen Beziehungen zwischen Mitarbeitern in direkter Interaktion oder in kleinen Gruppen. Vertrauen kann nicht durch Verträge, Vereinbarungen oder Regeln erzwungen werden und ist damit eine Erscheinung, die schwierig zu steuern ist. Dennoch ist es überaus wichtig für die Entwicklung und Verbreitung von Wissen.
Wissensmärkte innerhalb von Unternehmen sind folglich ein dynamisches und sensibles System das durch die Beziehungen zwischen Mitarbeitern bestimmt wird. Für den einzelnen Manager ist es kaum möglich, diese Prozesse wahrzunehmen (Kratzer, 2004). Dennoch gibt es bestimmte formelle und informelle Signale die Hinweise auf die Positionierung von Wissen geben. Zum einen gibt es eine formelle Struktur die aufzeigt, wer für was Verantwortung trägt. Es ist jedoch oft nicht der effizienteste Weg zum Chef der Marketingabteilung zu gehen, wenn man etwas über Marketing lernen will. Neben der formellen Struktur, dem Blueprint eines Unternehmens, gibt es eine informelle Struktur innerhalb derer Informationen und Wissen ausgetauscht werden. In diesen sogenannten informellen Netzwerken tauschen Mitglieder einer Organisation allerlei persönliche und berufliche Informationen über sich selbst und über andere aus, wie zum Beispiel über bestimmte Geschehnisse oder über die Zuverlässigkeit von Kollegen. Die Prozesse in informellen Netzwerken lassen Reputationen entstehen, können diese aber auch zerstören und sind somit eine überaus bedeutende Quelle von Informationen über das Funktionieren von Wissensmärkten. Informelle Kommunikation lässt nicht selten den Eindruck entstehen, es handele sich um belanglose Gespräche oder Klatsch. Doch bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass informelle Netzwerke Wissensnetzwerke sind, in denen unaufhörlich Wissen und Informationen zirkulieren. Ein drittes Signal ist das Bestehen von sogenannten communities of practice, welche aus Mitarbeitern mit den gleichen Interessen und dem gleichen Wissen bestehen. Communities of practice sind sehr oft eine Formalisierung von bestehenden informellen Netzwerken.
Wissensmärkte sind jedoch nicht immer effektiv und effizient. Verschiedene Faktoren können zum Scheitern der Entstehung und Verbreitung von Wissen führen, wie zum Beispiel das Wissen als Folge des Gewichts persönlicher Beziehungen in informellen Netzwerken oft nicht vollständig und gleichmäßig, sondern asymmetrisch und lokal begrenzt verbreitet wird. Andere Probleme können das Entstehen bestimmter Machtstrukturen, das Generieren künstlicher Engpässe und verschiedene Handelsbarrieren wie eine not-invented-here Mentalität in Subgruppen von Unternehmen sein.
3. Die Bedeutung der Soziologie für das Wissensmanagement
Die dargestellte Zusammenfassung des Werkes von Davenport und Prusak (1998) ist eine Illustration, wie stark soziologisch die Diskussion rund um das Konzept Wissensmanagement geprägt ist. Der überwiegende Teil der Diskussion über Wissensmärkte basiert auf Konzepten, die in der Soziologie schon seit Jahren thematisiert werden, jedoch nicht im Kontext der Diskussion um Wissensmanagement. Vor allem die Entwicklungen innerhalb der soziologischen Forschung der letzten Jahre sind vielversprechend und können hervorragend als Input zur Weiterentwicklung von Wissensmanagement dienen.
Wie schon erwähnt, beschäftigt sich Wissensmanagement mit der Entwicklung und Verbreitung von Wissen und bezieht sich somit zu einem großen Teil auf die Interaktionen von Personen innerhalb von und zwischen bestimmten Gruppen. Das Studium dieser Interaktionen ist ein klassisches soziologisches und sozial-psychologisches Thema. Vor allem die Beziehungen zwischen Individuen, bestimmte individuelle Verhaltensmerkmale oder die Leistung von Gruppen sind gut erforschte Gebiete. Wissen ist ein individuelles Merkmal (jemand weiß etwas), wird durch ein bestimmtes Verhalten von Individuen in einem größeren sozialen Kontext (zum Beispiel durch Interaktion) verbreitet und führt schließlich auf dem Niveau von Gruppen oder ganzen Unternehmen zu Lerneffekten durch eine Wissenserweiterung (oder auch nicht). Klassische soziologische Konzepte wie Märkte (Williamson, 1975), Reputation (Wilson, 1985), Reziprozität (Gouldner, 1960), Motivation (Homans, 1974) usw. sind alle von großer Bedeutung für solche Lernprozesse. Diese Prozesse sind schon seit langem Thema soziologischer Forschung und spielen gegenwärtig in den Diskussionen rund um Wissensmanagement eine zentrale Rolle.
Die klassischen Konzepte der Soziologie können die Diskussion um Wissensmanagement in der Praxis bereichern. Noch größer ist allerdings ihr Nutzen, wenn man eine relativ junge soziologische Forschungsdisziplin betrachtet: die soziale Netzwerkanalyse (Wasserman und Faust, 1994; Eccles und Nohria, 1992). Vor allem auf diesem Gebiet kann man der Soziologie vieles entnehmen, weil soziale Netzwerke ein zentraler Bestandteil von Wissensmanagement sind. Soziale Netzwerke kann man als ein Netz von Verbindungen betrachten, die dazu dienen, Wissen zu verbreiten. Wie soziale Netzwerke aussehen, wie sie entstehen, wie sie sich entwickeln und wann sie strukturell vorteilhaft für die Wissensentwicklung und -verbreitung sind, ist of nicht deutlich. Die Methode der sozialen Netzwerkanalyse vermag aber gerade diese Fragen zu beantworten. Mit der Hilfe dieser Forschungstechnik können Beziehungen zwischen Mitgliedern innerhalb von und zwischen bestimmten Gruppen und der Inhalt dieser Beziehung detailliert analysiert werden. Weiterhin machen es die Resultate sozialer Netzwerkanalyse möglich, in einer einfachen Art und Weise ineffiziente Strukturen aufzudecken. Um die Möglichkeiten der sozialen Netzwerkanalyse zu illustrieren, präsentieren wir im folgenden Forschungsresultate, die einen deutlichen Bezug zu wichtigen Problemstellungen von Wissensmanagement haben.
3.1 Über die Effektivität und Effizienz von sozialen Netzwerkstrukturen für die Verbreitung von Wissen
Im Kontext von Wissensmanagement geht es um die Verbreitung von Daten, Informationen und Wissen innerhalb und zwischen Gruppen oder Unternehmen. Eine bisher weitgehend unbeantwortete Frage ist jedoch, welche Strukturen sozialer Netzwerke zu einer effizienten und effektiven Verbreitung beitragen und welche nicht. Diese Frage wird umso interessanter wenn man bedenkt, dass sich diese Strukturen hauptsächlich in einem informellen Rahmen entwickeln und dadurch für das Management schlecht wahrnehmbar und schwer steuerbar sind (Leenders et al, 2003). Die soziale Netzwerkanalyse dient dazu diese Strukturen darzustellen. Aufgrund der daraus resultierenden Ergebnisse können Schwachstellen und "points of excellence" (Kratzer, 2001) herausgearbeitet werden.
Die Analyse von Wissensströmen wird durch die Untersuchung folgender Fragestellungen vorgenommen: "Was beinhalten Wissensströme?", "Wer sind die Wissensträger und wer gibt Wissen weiter?" und "Wann und in welchen Situation wird Wissen geteilt?" (Kratzer, 2001). Aus verschieden Forschungsergebnissen wird schnell deutlich, dass Wissen bestimmte Facetten hat (z.B., Kratzer, 2001; Wasserman & Galaskiewicz, 1994; Allen, 1984). Innerhalb von Unternehmen sind das
Diese drei verschiedenen Facetten von Wissen sind in der Literatur als managerial communication, problem-solving communication und friendly communication beschrieben (z.B., Kratzer et al. 1998; Leenders et al. 2003) [2]. Durch die Anwendung der sozialen Netzwerkanalyse sind diese drei Facetten, ihre strukturelle Einbettung und ihr zeitlicher Aspekt detailliert darzustellen und bestimmte Merkmale von Wissensströmen zu analysieren. Aus der Analyse wird deutlich, inwieweit bestimmte Wissensströme den Anforderungen genügen, um eine effektive und effiziente Wissensentwicklung und -verbreitung zu garantieren. Allein aufgrund dieser Erkenntnisse wird es dem Management möglich gemacht, entsprechend einzugreifen, wie das folgende Beispiel zeigt.
Ein geschichtliches Beispiel wird durch Jackson und Susskind (2000) in ihrer Studie über den Aufstieg der Medici Allianz in Venedig des 15. Jahrhunderts beschrieben. Jackson und Susskind (2000) machen darin deutlich, dass die Struktur der sozialen Netzwerke der Medici Allianz im Vergleich zu den Strukturen ihrer Konkurrenten der Grund für ihren Aufstieg war. Das entscheidende Merkmal in der Netzwerkstruktur der Medici war die zentrale Stellung von einigen wenigen Personen und die damit verbundene schnellere Bündelung von Macht, Einfluss und Aktionen im Vergleich zur ihren Konkurrenten. Außerdem wurde die Führung durch ihre äußerst zentrale Stellung viel weniger in Frage gestellt als in anderen Allianzen. Für ein Beispiel eines vollständig zentralisierten Netzwerkes siehe Abbildung 1.
Im Unterschied zu dem Erfolg der Medici führen stark zentralisierte Strukturen sozialer Netzwerke nicht immer zu positiven Ergebnissen. Uzzi (1997) zeigt anhand von Forschungs- und Entwicklungsteams das zentrale Strukturen auch zu unerwünschten Folgen führen können. Wenn soziale Netzwerke von Forschungs- und Entwicklungsteams zu stark zentralisiert sind, kommt es zu thick information (Uzzi, 1997). Diese sogenannten dicken Wissensströme können durch eine oder einige wenige zentrale Personen nicht mehr verarbeitet werden, diese Personen werden ganz einfach überladen mit Informationen. Dies hat zur Folge, dass das ganze Team weniger effizient und effektiv zusammenarbeiten kann. Diese Forschungsergebnisse von Uzzi wurden unter anderem von Leenders et al. (2003) und Kratzer et al. (2004) bestätigt. Neben der Zentralisation von sozialen Netzwerken gibt es natürlich noch andere strukturelle Merkmale wie die Intensität oder Kohäsion der Wissensverbreitung. Intuitiv empfindet man eine größere Intensität der Wissensverbreitung immer als positiv, "Je mehr desto besser" (siehe Abbildung 2). Wie die Forschung der letzten Jahre zeigt, ist dies nur die halbe Wahrheit. Eine höhere Intensität der Wissensverbreitung sorgt zwar in starken Maße für eine hohe Motivation und Einsatzbereitschaft (z.B., Homans, 1974; Coleman, 1990), kann aber auch die individuelle Kreativität in starken Masse blockieren (z.B., Nystrom, 1979; Kratzer, 2004) und gar zu der Entstehung von groupthink (Janis, 1982) beitragen. Von groupthink wird gesprochen, wenn Mitglieder von Gruppen "... are deeply involved in a cohesive ingroup, when the member"s strivings for unanimity override their motivation to realistically appraise alternative courses of action" (Janis, 1982, p.8).
Abbildung 1: Beispiel eines stark zentralisierten sozialen Netzwerks. Die zentrale Person unterhält direkte Kontakte mit allen anderen Personen in dem Netzwerk. Die anderen Personen haben keine Kontakte miteinander und sind damit abhängig von der zentralen Person. | |
Abbildung 2: Beispiel eines stark verbundenen sozialen Netzwerks mit einer hohen Intensität der Wissensverbreitung. Alle Personen des Netzwerkes sind durch Kontakte miteinander verbunden. | |
| Abbildung 3: Beispiel eines stark segmentierten sozialen Netzwerks. Die Abbildung zeigt zwei Gruppen von drei Personen, die nur durch einen Kontakt miteinander verbunden sind. |
In Unternehmen sind stark verbundene soziale Netzwerke eine mögliche Struktur, oft sind es jedoch Abteilungen, verschiedene Ausbildungsarten und Spezialisierungen oder einfach alterspezifische Unterschiede die soziale Netzwerke segmentieren - bis hin zu völlig isolierten Mitarbeitern (siehe Abbildung 3). Unternehmen sind natürlich keine völlig homogenen und hundertprozentig flachen sozialen Gebilde und somit ist eine gewisse Form der Segmentierung unausweichlich und in vielen Fällen selbst nützlich. Komplexe Aufgaben müssen in Teilaufgaben aufgegliedert werden und diese wiederum in weitere Teilaufgaben, so dass segmentierte Strukturen die logische Folge sind. Ein gutes Beispiel hierfür sind große Forschungsprojekte bei Unternehmen wie Airbus oder der Europäischen Raumfahrtgesellschaft. Bei der Europäischen Raumfahrtgesellschaft besteht das gegenwärtig größte Projekt HIFI (ein Teleskop als Auge eines Satelliten) aus 21 Teams die ihre Arbeit in 15 verschiedenen Ländern mit insgesamt rund 300 Mitgliedern verrichten. Bei Airbus dürfte der Personalaufwand noch um ein vielfaches höher sein. Durch die Tatsache das Segmentierung oft mit zunehmender Komplexität verbunden ist, darf sie keine extremen Formen annehmen. Die Ursache hierfür liegt darin, dass Menschen durch regelmäßige Interaktion lernen, einander zu verstehen. Wenn diese Interaktionen nicht stattfinden, kommt es zur Ausbildung von lokalen coding schemes, die durch Dearborn und Simon (1958) schon vor fünf Jahrzehnten beschrieben wurden. Mit der Folge, dass Personen mit verschiedenen beruflichen und sozialen Hintergründen und Zugehörigkeiten zu Subgruppen einander nicht mehr verstehen. Darum ist es unerlässlich dafür zu sorgen, dass genügend Interaktion stattfindet, um eine vollständige Isolation einzelner Subgruppen oder Personen zu verhindern. "Not only can large amounts of information be transmitted with relatively few specialized symbols, but through systematic selection and encoding rules, misinterpretations between team members are minimized" (z.B. Allen, 1984). Innerhalb des HIFI Projektes der Europäischen Raumfahrtgesellschaft wird dies zum Beispiel durch regelmäßige face-to-face Treffen aller betroffenen Mitglieder erreicht. Wenn man die inhaltlichen Facetten von Wissensströmen berücksichtigt, werden auch deutliche Unterschiede sichtbar, wie die folgenden zwei Beispiele zeigen. Soziale Netzwerke mit Bezug auf friendly communication sind stets weniger effizient und effektiv, wenn sie segmentiert sind (Kratzer, 2004). Ein segmentiertes soziales Beziehungsnetzwerk in Unternehmen sorgt in den meisten Fällen für eine schlechte Atmosphäre mit der Konsequenz, dass Wissen weder den Anforderungen gemäss entwickelt noch weitergegeben wird. Ein ganz anderes Bild offenbart sich, wenn man sich managerial communication anschaut. Die Organisation und Koordination von Arbeitsprozessen erzwingt ein strukturelles Vorgehen mit der Folge, dass diese Wissensströme erst effektiv und effizient funktionieren, wenn sie segmentiert sind.
Es zeigt sich also, dass es durch die systematische Darstellung von sozialen Netzwerken möglich wird, die Effizienz und Effektivität von Wissensströmen zu analysieren. Die soziale Netzwerkanalyse unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Facetten von Wissen. Damit ist es möglich, Wissensnetzwerke auf verschiedenen Ebenen zu analysieren, so dass bestimmte Strukturen auf Teamebene, Abteilungsebene oder Unternehmensebene herausgefiltert werden können. Durch die Analyse dieser Strukturen wird es möglich, Stärken ebenso wie Schwachstellen zu erkennen und dementsprechend einzugreifen, um die angestrebte Effizienz und Effektivität zu erreichen. Für eine Diskussion möglicher Interventionsmöglichkeiten siehe unter anderem Hollander (2002), Kratzer et al. (2001), and Leenders et al. (2003). Die präsentierten Beispiele machen deutlich, in welchem Umfang die Analyse sozialer Netzwerke einen Mehrwert für das Wissensmanagement bedeuten kann und inwieweit beide Konzepte inhaltlich Hand in Hand gehen.
3.2 Die Rolle von Kommunikations- und Vertrauensnetzwerken
Die Analyse sozialer Netzwerke wird noch interessanter, wenn man sie mit der zunehmenden Bedeutung der wechselseitigen Abstimmung von Arbeitsaktivitäten verbindet. In der Managementliteratur wird den Beziehungen von Mitarbeitern untereinander stets mehr Bedeutung geschenkt. So wird z.B. oft erwartet, dass Mitarbeiter in Teams sich gegenseitig unterstützen. Die Vorteile dieser gegenseitigen Hilfe zwischen Mitarbeitern werden in der heutigen Managementliteratur als selbstverständlich wahrgenommen. Den Bedingungen, die das Teilen von Wissen erst ermöglichen, wird dabei jedoch oft zu wenig Beachtung geschenkt, wie zahlreiche Beispiele aus wissenschaftlichen Fallstudien sowie Beschreibungen in Managementpublikationenverdeutlichen. Die Botschaft dieser Beispiele ist deutlich: Wissen ist nicht allgegenwärtig, sondern ein knappes Gut. Für die optimale Nutzung von Wissen in Organisationen hat diese Tatsache eine Reihe von wichtigen Konsequenzen.
Erstens, ist es erforderlich, dass jene Organisationsmitglieder die in einem bestimmten Bereich über einen Wissensvorsprung verfügen bereit sind, ihre Expertise an andere weiterzugeben. Sehr oft stößt der Wissenstransfer schon in dieser Phase auf Probleme. Sehr erfahrene Mitarbeiter haben oftmals keine Zeit, ihr Wissen im Detail mit anderen Mitarbeitern zu teilen, weil gerade etwas unerfahrene Mitarbeiter oft die Zeit ihrer erfahreneren Kollegen überbeanspruchen. Auch organisationspolitische Gründe können die Weitergabe von Wissen behindern. So werden oftmals sehr mühsam gewonnenen Erkenntnisse durch andere missbraucht und als ihre eigenes Wissen weitergegeben. Die Bereitschaft, Wissen mit anderen zu teilen, wird durch solche Geschehnisse oft zusätzlich verringert. Die zweite Vorrausetzung besteht in der Bereitschaft, andere um Rat zu fragen. Auch diese Vorraussetzung ist nicht so selbstverständlich, wie gemeinhin angenommen wird. Jemanden um Rat zu fragen wird oft gleichgesetzt mit Inkompetenz, bzw. als ein Eingeständnis, dass man ein bestimmtes Problem nicht selbständig lösen kann. Die Folge ist dass die eigene Reputation als Experte Schaden nimmt. Der Anreiz, andere um Rat zu fragen, nimmt hierdurch ab.
Sowohl das Geben als auch das Einholen von Ratschlägen bringt also Vorteile und Kosten mit sich. Sender und Empfänger werden erst dann ausreichend motiviert sein, ihr Wissen mit anderen zu teilen, wenn der Nutzen davon die Kosten übersteigt. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen ist dies am wahrscheinlichsten?
Die Analyse von sozialen Netzwerken kann hier nützliche Einsichten verschaffen. Wie soeben skizziert sind die Kosten, die mit dem Teilen von Wissen verbunden sind oft nicht allein materieller Natur (etwa gemessen an der Zeit die jemand darauf verwendet, einem Kollegen einen Ratschlag zu geben), sondern auch - oder oft sogar: vor allem - sozialer Natur. Individuen fürchten den Verlust von Reputation sowie Trittbrettfahrerverhalten oder opportunistischer Ausbeutung durch ihre Kollegen. Je größer das wahrgenommene Risiko von Reputationsverlust oder Opportunismus ist, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass jemand sein Wissen mit anderen teilt. Die Einbettung der Ratsuchenden und Ratgebenden in ein soziales Netzwerk von Vertrauensbeziehungen kann hier eine entscheidende Rolle spielen, da ein dichtes Vertrauensnetzwerk die Wahrscheinlichkeit des Wissensaustausches deutlich erhöht (Wittek, 1999). Konkret bedeutet dies, dass eine offene und kooperative "Wissenskultur" in Unternehmen dort am Wahrscheinlichsten ist, wo die Überlappung zwischen Ratschlag- und Vertrauensnetzwerken am größten ist. Die Analyse dieser Netzwerke kann folglich aufdecken, ob die Verbreitung von Wissen innerhalb eines Unternehmens reibungslos und ohne Probleme verläuft und wo es Schwachstellen des Wissenstransfers gibt.
Die Ereignisse in einem Managementteam eines deutschen Papierkonzerns illustrieren diesen Zusammenhang sehr anschaulich (Wittek, 1999). Die meisten der 25 Manager des Teams sind Papieringenieure oder Papiermachermeister. Im Jahre 1995 bekam das Team den Auftrag, eine neue Produktionshalle zu bauen und eine neue Papiermaschine zu installieren. Was folgte war eine Teamleistung die beinahe aus einem Lehrbuch stammen könnte, nicht nur hinsichtlich des Neubauprojektes, sondern auch in Hinblick auf das Lösen von komplexen technischen Problemen, wie sie bei Papiermaschinen zahlreich auftreten. Die laufende Produktion funktionierte hervorragend, man half einander wo man nur konnte, und jedes Mitglied teilte sein Wissen mit anderen, wenn nötig. Eine Analyse der sozialen Netzwerke zu diesem Zeitpunkt zeigt, ein - verglichen mit den späteren Messungen - relativ dichtes Vertrauensnetzwerk. Diese den Wissensaustausch stimulierenden Strukturen veränderten sich aber abrupt nach der erfolgreichen Beendigung des erwähnten Projektes. Durch das Eingreifen des Mutterkonzerns in die Personalstruktur seiner Tochterunternehmen entstand eine Vertrauenskrise. Die Dichte des Vertrauensnetzwerkes ging innerhalb eines halben Jahres um die Hälfte zurückging. In ziemlich kurzer Zeit entstanden immer mehr Beschwerden über Kollegen die sich weigerten, Rat zu geben und über Kollegen die fremde Ideen als ihre eigenen präsentierten. Eine Netzwerkanalyse machte deutlich, dass ziemlich schnell nach der Abnahme der Anzahl von und Dichte der Vertrauensbeziehungen in diesem Team auch die Bereitschaft, Ratschläge zu geben oder zu befolgen enorm abgenommen hatte. Auf einmal war man weit entfernt von einer Situation, in der Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens reibungslos und ohne Probleme verläuft. Erst nach einem erneuten Eingriff des Mutterkonzerns in die Personalstruktur der Tochterunternehmen sollte sich dieser Zustand wieder normalisieren. Nach diesem Eingriff nahm erst die Dichte des Vertrauensnetzwerkes wieder zu, die Beschwerden über unkooperative oder opportunistische Kollegen nahmen ab, und der Wissensaustausch verlief wieder reibungslos. Dieses Beispiel macht deutlich, dass verschiedene Sorten von Netzwerkstrukturen eine ausschlaggebenden Bedeutung haben für das Umsetzen von Wissensmanagement in der Praxis.
3.3 Wissensentwicklung als kollektives Gut: Soziale Netzwerke und individuelle Motivation
Bisher sind Wissensnetzwerke als Systeme betrachtet worden in denen Individuen ihr Wissen teilen und damit verbreiten (oder auch nicht). Aber das Entwickeln von Wissen als Grundlage des Wissenstransfers ist deutlich komplizierter. Bestimmte Formen der Wissensentwicklung, aber auch Verbreitung, basieren nämlich auf der Leistung eines freiwilligen Beitrages für eine bestimmte Gruppe an Stelle einer individuellen Entscheidung Wissen zu teilen oder nicht. Wenn jedes Mitglied einer Gruppe etwas in das Wohl der Gesamtgruppe investiert, hat jedes Mitglied in der Zukunft einen Nutzen von dem gemeinsamen Endprodukt (das sogenannte kollektive Gut). Aber es ist für das einzelne Mitglied einer Gruppe natürlich erstrebenswert, so wenig wie möglich zu investieren und trotzdem von dem gemeinsamen Endprodukt zu profitieren. Nun betrifft diese Überlegung natürlich alle Mitglieder von Gruppen was es schwierig macht überhaupt ein gemeinsames Endprodukt zu erschaffen. Wenn allerdings kein kollektives Gut generiert wird haben alle Mitglieder hierdurch einen Nachteil.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Dokumentation von Programmierarbeiten oder bestimmten Designschritten in Entwicklungsprojekten in der Softwareindustrie. Softwaredokumentation wird von Projektmitarbeitern häufig als lästige Pflicht empfunden, vor allem unter dem Zeitdruck der in diesen Projekten meistens herrscht. Erschwerend kommt noch hinzu, dass es für das Management schwierig zu kontrollieren ist ob die Dokumentation ausreichend und in der angestrebten Form geschehen ist. Demgegenüber ist sich jeder in solchen Projekten der Tatsache bewusst, dass eine unzureichende Dokumentation vor allem in großen Projekten zu enormen Problemen führen kann, die sich dann wieder in Kosten für alle Beteiligten ausdrücken, wie möglicher Mehrarbeit (Millennium Bug) bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes. Dieses Beispiel illustriert ein wichtiges Problem für das heutige Wissensmanagement, nämlich, die Analyse der Bedingungen unter denen Mitarbeiter ausreichend motiviert sind, zu dem kollektiven Gut "Wissen" beizutragen.
Soziologische Forschung hat zwei Faktoren herausgefiltert die den Beitrag des Einzelnen am kollektiven Gut maßgeblich bestimmen und darum auch auf die Entwicklung von Wissen anwendbar sind. Zum einen ist das individuelle Interesse des Einzelnen am kollektiven Gut von entscheidender Bedeutung (Marwell und Oliver, 1993). Es ist selbstverständlich, dass Mitarbeiter stärker zu der Entwicklung von Wissen beitragen, wenn sie aufgrund ihrer Funktion ein deutliches Interesse mit einem reibungslosen Wissenstransfer verbinden. Die Frage ist nur inwieweit dieses Interesse spezifiziert werden kann? Zum zweiten gibt es natürlich ein gewisses Maß an individueller Kontrolle zwischen den Mitgliedern von Teams oder ganzen Unternehmen. Mitglieder werden sich im allgemeinen deutlich mehr anstrengen und damit stärker zum kollektiven Gut beitragen, wenn diese Anstrengungen durch andere Mitglieder entsprechend honoriert werden. Die Frage ist dann, wie die soziale und informelle Belohnung gemessen werden kann und unter welchen Bedingungen sie zustande kommt? Antworten auf beide Fragen lassen sich im Rahmen der Erforschung sozialer Netzwerke finden, wie die folgenden Beispiele belegen
Ein Beispiel von Collins (1974) zeigt, wie die individuelle Position innerhalb des Netzwerkes von Wissensströmen nicht ausschließlich durch die Abhängigkeiten innerhalb dieses Netzwerks, sondern auch durch das Verhalten von Personen und sogar Abteilungen bestimmt wird. Collins (1974) untersuchte in den siebziger Jahren die Kommunikationswege zwischen sieben Forschungslaboratorien die an der Entwicklung eines neuen Lasers beteiligt waren. Diese Laboratorien standen in Konkurrenz zueinander, hatten aber auf der anderen Seite ein gemeinsames Interesse ihr Wissen zu teilen. Die Verbreitung dieses Wissens geschah üblicherweise durch die Publikation von neuen Entdeckungen in wissenschaftlichen Zeitschriften, auch wenn dabei nicht alle Details preisgegeben wurden. Gleichzeitig wurde Wissen in persönlichen Beziehungen ausgetauscht. Dabei entstand ein informelles Netzwerkgefüge von Personen und Laboratorien die mehr oder weniger in das Projekt involviert waren. Das auffallende daran war der Unterschied von Kommunikationsstrategien im Hinblick auf unterschiedliche Netzwerkpositionen. Collins (1974) fand heraus das die Laboratorien die eine zentralere Position innerhalb des Wissensnetzwerkes einnahmen auch deutlich stärker bereit waren, ihr Wissen mit anderen Laboratorien zu teilen als Laboratorien, die eher an der Peripherie des Netzwerkes angesiedelt waren. Aus der Analyse dieses Netzwerkes wurde damals deutlich, und ist später mehrfach bestätigt wurden, das bei einem intensiven Austausch von Wissen die zentralen Positionen mit dem meisten und dem neusten Wissen versorgt werden. Um seine zentrale Position zu verteidigen stimulierte das am stärksten zentral stehende Laboratorium den Wissenstransfer zwischen allen Laboratorien dadurch, dass es selbst kontinuierlich Wissen an die anderen weitergab. Auf diesem Wege entstand eine positive Belohnungsspirale, oder mit anderen Worten, das am stärksten zentral stehende Laboratorium bekam dadurch das insgesamt viel Wissen weitergegeben wurde selbst auch viel Wissensinput. Aus der Analyse von Collins (1974) wurde gleichzeitig deutlich, dass das Laboratorium das am zentralsten positioniert war auch am erfolgreichsten war.
In der Organisationsforschung wurde wiederholt gezeigt, dass informelle Belohnungen, wie Lob, Kritik oder Respekt vor der Leistung des anderen stark motivierend wirken (Seashore, 1954; Homans, 1974). Jedes Mitglied eines Teams oder einer Unternehmung kann es schwer und vielleicht sogar lästig finden zu einem kollektiven Gut beizutragen, hat aber in jedem Fall ein Interesse daran, dass andere einen Beitrag leisten. Darum wird in der Regel versucht andere dementsprechend zu motivieren, wenn die Kosten dafür nicht zu hoch sind. Soziale Belohnungen machen es oft möglich mit geringen Kosten einen großen Effekt zu erzielen. Wie der Soziologie Coleman (1990) schreibt: "An expression of encouragement or graditude for anothers" action may cost the actor very little but provide a great reward for the other" (p. 277). Eine interessante Tatsache, aber die Effektivität sozialer Belohnungen scheint darueberhinaus durch die Struktur des sozialen Netzwerkes bestimmt zu werden innerhalb dessen diese Belohnungen erfolgen. Die Frage ob Wissen entwickelt wird oder nicht hängt folglich nicht nur von der Belohnungsstruktur ab, sondern auch von der Struktur des sozialen Netzwerkes. Mit der Hilfe der Analyse sozialer Netzwerke kann bestimmt werden, inwieweit Mitarbeiter persönliche Beziehungen zu Kollegen haben, die ein Interesse an der Entwicklung von Wissen haben. Ein Softwareingenieur der persönliche Kontakte überwiegend mit Personen außerhalb seines Arbeitsteams pflegt ist sicher schwierig durch soziale Belohnungen innerhalb seines Teams zu motivieren. Im umgekehrten Fall kann die Entwicklung von Wissen aber auch abgebremst werden, wenn das Interesse an persönlichen Beziehungen das Interesse an dem Wissensgut übersteigt. Experimentelle Forschung und Umfrageforschung in Organisationen belegen, dass sehr starke persönlichen Beziehungen innerhalb eines Teams selbst zu einer Verminderung der Bereitschaft führen kann, zu einem kollektiven Gut beizutragen (Flache, 1996, 2003). Langfred (im Erscheinen) findet einen ähnlichen Effekt. Er zeigt an einer Studie von studentischen Projektteams, dass ein hohes Mass an Vertrauen zwischen Gruppenmitgliedern einen negativen Effekt auf die Teamleistung haben kann. Dieser Effekt tritt dann auf, wenn Teammitglieder in ihren Aufgaben sehr autonom sind, aber gerade deswegen eigentlich ein gewisses Maß an Kontrolle und gegenseitiger Beobachtung notwendig wäre. Langfred konnte zeigen, dass unter diesen Bedingungen starkes Vertrauen in Teamkollegen eher kontraproduktiv ist, weil es eine geringere Kontrollbereitschaft zur Folge hat.
Die Schwierigkeit besteht also darin ein Netzwerk persönlicher Beziehungen an ein Netzwerk von Interesse an dem kollektiven Wissensgut so zu koppeln, dass soziale Beziehungen für gegenseitige Motivation eingesetzt werden, anstatt Selbstzweck zu sein oder Sozialer Kontrolle eher entgegen zu wirken. Die soziale Netzwerkanalyse kann helfen diese Aufgabe zu lösen, weil sie Einsichten in die Strukturen von persönlichen Beziehungen und Interessen gibt und so erst ein zielgerichtetes Eingreifen des Managements ermöglicht.
4. Schlussfolgerung
Im vorliegenden Artikel wurde der Versuch unternommen, den potentiellen Beitrag der sozialen Netzwerkanalyse für das Wissensmanagement aufzuzeigen. Sowohl auf theoretischer Ebene als auch in der unternehmerischen Praxis kann die soziale Netzwerkanalyse einen signifikanten Mehrwert darstellen und die Kenntnis über das Wissensmanagement vergrößern. So gilt es, die mehr oder weniger unabhängig voneinander geführten Diskussionen über Wissensentstehung und Wissenstransfer in der Praxis und der wissenschaftlichen Forschung zu verbinden, insbesondere weil es scheint, als ob viele von der Wissenschaft bereits erkannten und gelösten Probleme in der Praxis erneut definiert und Lösungen dafür gesucht werden.
Dennoch sollte sich die Praxis nicht ausschließlich an der sozialwissenschaftliche Forschung orientieren. Die Forschung wiederum kann aus konkreten Problemen, die sich in der Praxis stellen, lernen und ihre Erkenntnisse dadurch verfeinern und konkretisieren. Die gegenseitige Anregung von wissenschaftlicher Forschung und unternehmerischer Praxis erscheint uns daher besonders wichtig. Vor allem auf dem Gebiet von Wissensmanagement scheint dies möglich, denn die Soziologie liefert Einsichten, die die Praxis sofort als Input verarbeiten kann. Auf der anderen Seite wird die soziologische Forschung vor die sich verändernden Problemlagen in Unternehmen gestellt und muss darauf Antworten finden.
Die Analyse sozialer Netzwerke ist durch intensive wissenschaftliche Forschung zu einer sehr nützlichen und zuverlässigen Methode geworden und hat in den letzten Jahren ihre Nischenposition verlassen. Dies zeigt sind insbesondere daran, dass Unternehmensberatungen wie die IBM Consulting Group oder McKinsey begonnen haben, die soziale Netzwerkanalyse in der unternehmerischen Praxis einzusetzen. Diese Entwicklung steht jedoch noch an ihrem Beginn und unser Anliegen ist es daher, durch die vorliegende Veröffentlichung deutlich zu machen, wie eine in vielen Aspekten einfache Methode nutzbringend in der betriebwirtschaftlichen Praxis eingesetzt werden kann und sollte. Die Konzepte von Wissensmanagement können damit sinnvoll ergänzt werden.
Fußnoten
[1] Eine ähnliche Entwicklung gab es mit dem Konzept Kultur in den achtziger Jahren (Barley, Meyer und Gash, 1988).
[2] Diese Strukturen werden in der Literatur auch als das Nervensystem von Organisationen beschrieben und erlauben Mitarbeitern gemeinsame Arbeiten auszuführen. Schon Bavelas schlussfolgerte "communication is not a secondary or derived aspect of organization - a "helper" of the other and more basic functions. Rather, it is the essence of organized activity and is the basic process out of which all other functions derive" (1951; p. 368).
Literaturverzeichnis
Autoren
Dr. Jan Kratzer studierte Soziologie und Betriebswirtschaft in Leipzig. Gegenwärtig ist er als Assistant Professor for Business Development and Strategy an der betriebwirtschaftlichen Fakultät der Universität in Groningen (Niederlande) tätig. Seine Forschungsaktivitäten richten sich vor allem auf das funktionieren von Kommunikations-Netzwerken, sowie auf den Umgang mit Virtualität in Unternehmen, insbesondere im Forschung- und Entwicklungsbereich.
Dr. Kees van Veen studierte Soziologie in Groningen (Niederlande). Gegenwärtig ist er als Assistant Professor for International Business an der betriebwirtschaftlichen Fakultät der Universität in Groningen (Niederlande) tätig. Seine Forschungsaktivitäten richten sich vor allem auf Human Resource Management, sowie den Effekten des Einsatzes von Informationstechnologie in Unternehmen.
Dr. Andreas Flache studierte Informatik and Sozialwissenschaften in Koblenz. Gegenwärtig ist er als Postdoktoraler Forscher am ICS tätig. Seine Forschungsaktivitäten richten sich vor alle auf dynamische Modelle von sozialen Netzwerken und der Anwendung von Computersimulationen in der Soziologie.
Prof. Dr. Raffael M.P. Wittek studierte Soziologie und Kulturelle Anthropologie in TübingenGegenwärtig ist er als Professor an der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität in Groningen (Niederlande) tätig. Seine Forschungsaktivitäten richten sich vor allem auf Gebiete des Konfliktmanagements und auf Veränderungsprozesse in Organisationen.
Kommentare
Das Kommentarsystem ist zurzeit deaktiviert.
Themengruppen
Dieser Beitrag ist den folgenden Themengruppen zugeordnet
Schlagworte
Dieser Beitrag ist den folgenden Schlagworten zugeordnet